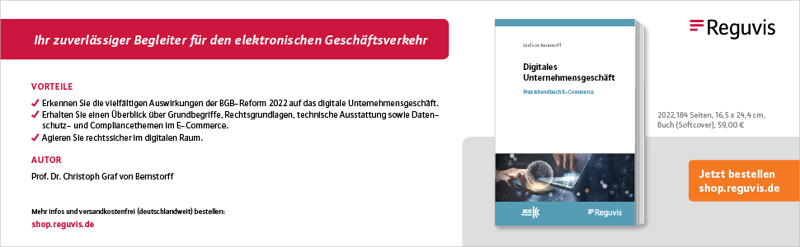Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff
Aktuelles zum digitalen Unternehmensgeschäft
Wichtige Gesetzesänderungen stellen neue Anforderungen an Unternehmen
In den vergangenen Monaten sind viele neue Gesetzesbestimmungen zum Onlinehandel in Kraft getreten, die deutlich verschärfte Anforderungen an im Internetgeschäft tätige Unternehmen stellen.
Die Anforderungen an Unternehmen steigen ständig. Nicht nur Märkte, Marktrisiken, Marktteilnehmer:innen und neue Produkte fordern Aufmerksamkeit, sondern auch die seit einigen Jahren rasant wachsenden neuen Möglichkeiten der „elektronischen Geschäfte“ stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Vor einigen Jahrzehnten noch fast undenkbar, werden nationale wie auch internationale Handelsgeschäfte heute häufig auf elektronischem Wege abgeschlossen. Mussten früher noch mit großem zeitlichen und finanziellem Aufwand Hardware und Software eingekauft, installiert und gewartet werden, kann heute auch auf externe Dienstleister:innen zurückgegriffen werden, die die stets neueste Version von betriebswichtigen Programmen zum Abschluss, zur Abwicklung oder Sicherung von Geschäften vorhalten. Das richtige Benutzen von Datenautobahnen entscheidet damit immer stärker auch über den geschäftlichen Erfolg.
Die Begriffe Electronic Business (eBusiness), Electronic Commerce (eCommerce), elektronischer Geschäftsverkehr oder auch elektronischer Handel/digitaler Handelsverkehr werden in der Unternehmenspraxis unterschiedlich gebraucht. Sie stehen entweder für die Automatisierung von Geschäftsprozessen im Unternehmen (eBusiness), oder aber sie gehen weiter und umfassen auch die Geschäftstätigkeit selber, also die Geschäftsabschlüsse zwischen Unternehmen, und stehen dann für „elektronischen Handel“/„digitaler Handel“ oder das elektronische Unternehmensgeschäft an sich (eCommerce).
Die neuesten gesetzgeberischen Aktivitäten sowie Gesetzesregelungen sprechen fast durchweg vom „digitalen“ Markt und von „digitalen“ Dienstleistungen, so wie beispielsweise die jüngsten Rechtsakte des EU Digital Market Act sowie des EU Digital Services Act aus dem Jahr 2022.
Daneben hat die Umsetzung gleich mehrerer EU-Richtlinien in den Jahren 2021 und 2022 dazu geführt, dass es viele neue Verbraucherschutznormen im deutschen Recht gibt, die sich als inhaltlich geänderte oder gänzlich neue Vorschriften u.a. im BGB und EGBGB wiederfinden.

Die seit 2022 neu in Kraft getretenen Gesetzesnormen führen zu einer Verbesserung des Verbraucherschutzes vor allem im Onlinehandel, dem eine deutliche Verschärfung der an Unternehmen gestellten Anforderungen hinsichtlich Sorgfalts- und Informationspflichten gegenübersteht.
Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff
Konsequenzen für Unternehmen
Die hier nur stichwortartig genannten Neuerungen führen zu unterschiedlichen Auswirkungen auf das Unternehmensgeschäft. So gibt es neue Regelungen im Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), und zwar in den in Art. 246 und 246 a bis e EGBGB. Es sind u.a. neue Bußgeldvorschriften erstmals in das EGBGB eingefügten Art. 246 e EGBGB enthalten, und einige weitere von Unternehmen zu beachtende Normen wurden in Nebengesetze eingefügt.
Soweit Unternehmens-AGB betroffen sind und damit Überprüfungs- und möglicher Änderungsbedarf besteht, geht es um alle AGB, die in Kaufverträgen mit Verbraucher:innen eingesetzt werden. Unternehmen müssen aufgrund der vielen seit 2022 geltenden Neuerungen – vor allem für ihr B2C-Geschäft – ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen überprüfen und ggf. auf die neue Gesetzeslage anpassen.
Da der Anwendungsbereich der EU-Verbraucherrechte-Richtlinie ausgedehnt wurde, gilt ihr seit dem 13. Juni 2014 in Deutschland anzuwendender Inhalt
- ab 2022 auch für Verträge mit digitalen Inhalten
- und für digitale Dienstleistungen,
- sofern der oder die Verbraucher:in dem Unternehmen dazu personenbezogene Daten stellt
- und der Unternehmer diese Daten – über die rechtlichen Anforderungen hinaus – auch verarbeitet.
Verträge, bei denen der oder die Verbraucher:in mit seinen/ihren Daten „bezahlt“, werden damit den entgeltlichen Verträgen gleichgestellt; dies kann bei allen Verträgen über rein digitale Inhalte wie Apps oder Software bis hin zu Streamingdiensten von Musik und Video der Fall sein (vgl. § 312 k BGB).
Außerdem wurde in 2022 als neuer Begriff neben den schon bekannten „Waren“ auch das „digitale Produkt“ eingeführt, wie sich aus der Neufassung von Art. 246 Abs. 1 a EGBGB entnehmen lässt. Waren und digitale Produkte eröffnen den Verbraucher:innen neue Rechte, von denen (z.B. durch AGB-Regelung) nur noch abgewichen werden kann, wenn bestimmte, in den neu gefassten Normen des BGB enthaltene Anforderungen erfüllt werden.
Fazit
Die seit 2022 neu in Kraft getretenen Gesetzesnormen führen zu einer Verbesserung des Verbraucherschutzes vor allem im Onlinehandel, dem eine deutliche Verschärfung der an Unternehmen gestellten Anforderungen hinsichtlich Sorgfalts- und Informationspflichten gegenübersteht. Wollen Unternehmen drohende Abmahnungen oder Bußgelder vermeiden, sollten sie vor allem überprüfen, ob ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen den neuen Gesetzesanforderungen noch gerecht werden.
Über den Autor
Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff war bis Mitte 2022 als Rechtsanwalt in einer großen Wirtschaftskanzlei mit Sitzen in Hamburg und Bremen tätig und ist als Professor für internationales Wirtschaftsrecht an der Hochschule Bremen auch weiterhin als Unternehmensberater aktiv. Er ist Autor einer Vielzahl aktueller Fachbücher für die Außenhandelspraxis und Mitglied der ICC-Kommission für internationales Handelsrecht.
Header © UnitoneVector – IStock 1158184189

Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)